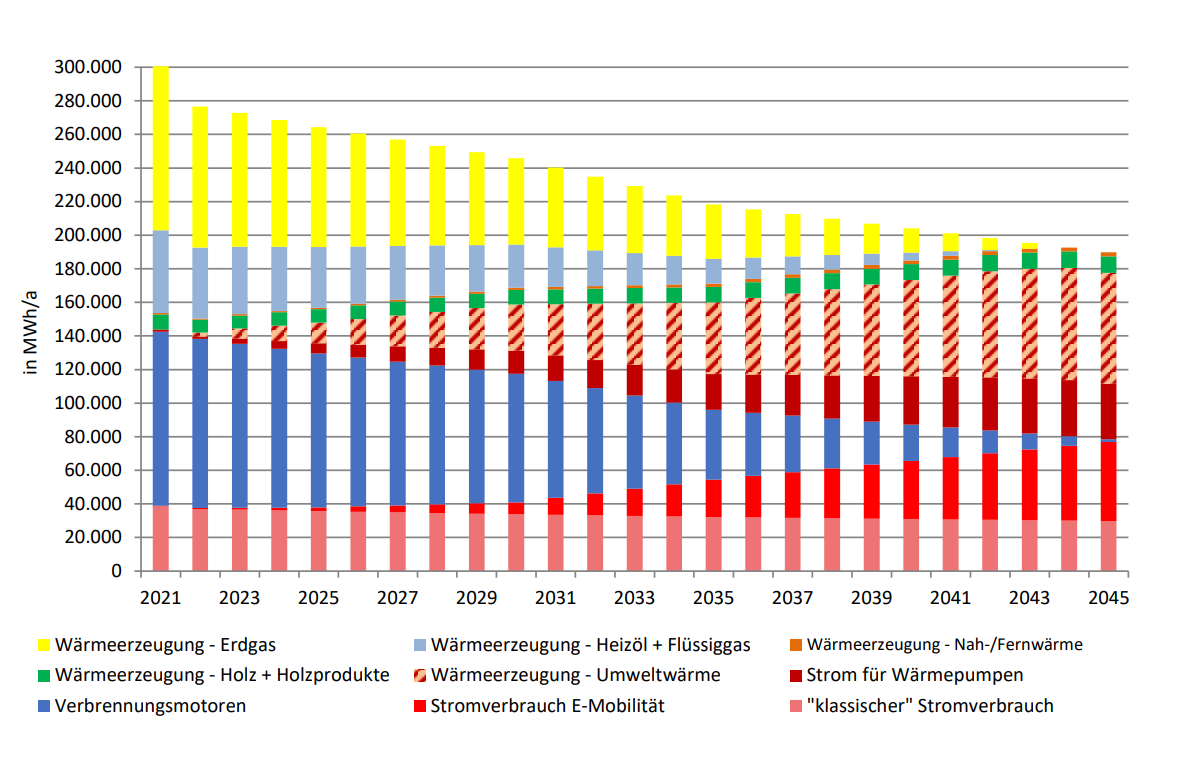Die KlimaKom gemeinnützige eG freut sich, die Eröffnung eines neuen Standorts in Nördlingen mit Barbara Wunder bekanntzugeben. Mit dieser strategischen Erweiterung schafft KlimaKom einen regionalen Ansprechpartner in Schwaben, der sich auf nachhaltige und resiliente Entwicklungskonzepte und Klimastrategien für urbane und ländliche Räume konzentriert. Der Standort wird als Schnittstelle für Kommunen, Unternehmen und Bürger dienen und mit umfassender Expertise in Klimaschutzstrategien, Innenentwicklung, regionaler Zukunftsgestaltung, Kommunalentwicklung und Flächensparmaßnahmen unterstützen. Die Regionalentwicklerin und Expertin für Innenentwicklung Barbara Wunder ist in der Region bestens bekannt und vernetzt. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in diesem Bereich, ist zertifizierte Moderatorin und Dozentin und steht im Bereich Stadt- und Regionalentwicklung kurz vor Abschluss ihrer Promotion.
Eine zentrale Aufgabe des neuen Bürostandortes ist es, nachhaltige Stadt-, Gemeinde- und Regionalentwicklungskonzepte für Kommunen und Initiativen in Schwaben zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehören auch die Begleitung, Umsetzung und Moderation von ILEK- und ISEK-Prozessen, gefördert vom Amt für ländliche Entwicklung, die den Gemeinden helfen, ihre weiteren Entwicklungspfade zukunftsfähig zu gestalten.
Das Angebot am Standort Nördlingen wird darüber hinaus Zukunftslabore für Städte und Gemeinden organisieren – innovative Workshops und Think-Tank-Formate, die unter anderem neue Ideen für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung hervorbringen sollen. Die KlimaKom gemeinnützige eG hat langjährige Expertise zu Klimaschutz, Wohnraumentwicklung, Flächeneffizienz, Klimaanpassung, Bildungsprogrammen für nachhaltige Entwicklung, Gemeindeentwicklungskonzepten, regionalen Strategieprozessen, zur Anfertigung von wissenschaftlichen Studien, der Begleitung von Städten und Gemeinden bei Entwicklungskonzepten und vielem mehr. Mit der Erarbeitung von Klimahandbüchern bietet KlimaKom zudem ein praxisorientiertes Werkzeug für Kommunen und Unternehmen, um maßgeschneiderte Strategien zur eigenen Klimaanpassung zu entwickeln. Mit der Ausarbeitung von lokalen Entwicklungsstrategien, als Grundlage für eine LEADER-Förderung, unterstützt KlimaKom die LEADER-Managements zur Stärkung der Lebensqualität und der ökologischen und ökonomischen Resilienz. Alle Strategien und Konzepte werden partizipativ in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Bürgerinnen und Bürgern und weiteren regionalen Akteuren erarbeitet.